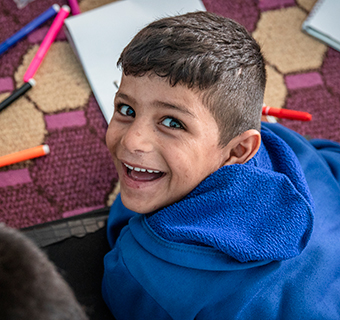Im Angesicht der Katastrophe müssen wir harte Entscheidungen fällen
Als Mitarbeiterin von Save the Children war ich bereits bei zahlreichen Erdbeben, Tsunamis und Fluten im Einsatz. Alle diese Naturkatastrophen haben eines gemeinsam: Das erste Helferteam besteht immer aus Ortsansässigen. Freiwillige der Gemeinden finden sich zusammen, um Verletzte aus Schuttbergen herauszuziehen, um die wenigen Nahrungsmittel untereinander zu verteilen und sich um Kinder zu kümmern, die von ihren Familien getrennt wurden. Taxifahrer, Juristen, Obstverkäufer, Vollzeitmütter und mürrische Teenager folgen alle der spontanen Berufung als Hilfsarbeiter.

Auch in Nepal war das so. Sobald das Erdbeben verebbte, beeilte sich jeder, seinem Nächsten zu helfen. Jetzt, fünf Tage später, kauern immer noch Familien unter brüchigen Plastikplanen zusammen, unterstützen und trösten sich gegenseitig, auch wenn ihre eigenen Essens- und Wasservorräte schwinden. Da es so unglaublich viele sind, ist das Bild, das sich bietet, eher frustrierend.
Obwohl gut vorbereitet, kämpfen wir gegen das Chaos an
Save the Children ist schon sehr lange in Nepal, wir haben hier seit 1976 verschiedene Entwicklungsprojekte auf den Weg gebracht und begleitet, so dass wir über eine Menge an Nothilfe-Material verfügten. Es war in dieser immens großen Katastrophe aber sehr schnell aufgebraucht. Ein Aufruf ging durch alle internationalen Teams von Save the Children: Nepal brauchte Notfall-Materialien und Notfall-Personal, und zwar sofort. Viele unserer Katastrophen-Einsatz-Teams erreichte der Aufruf am Samstagnachmittag, auch mich, und innerhalb von Minuten versuchte unser Logistik-Team, uns in ein Flugzeug zu setzen.
Unsere Pläne wurden laufend durchkreuzt. Erst war der Flughafen nicht offen, dann doch. Erst flogen die Flugzeuge nicht, dann doch, wurden aber in letzter Minute nach Indien oder China umgelenkt. Theoretisch hätten wir von dort über Land weiterreisen können, aber das hätte uns weitere ein bis zwei Tage gekostet. Auch Flugzeuge mit lebensrettenden Hilfsmitteln wurden umgeleitet. Wir haben uns die Haare gerauft, um Kathmandu zu erreichen.
Schließlich konnte ich einen Flugzeugsitz ergattern, musste dann aber gemeinsam mit 50 anderen Helfern fünf Stunden lang über dem zerstörten Kathmandu kreisen, ohne es erreichen zu können. Der Flughafen der nepalesischen Hauptstadt ist klein und seine Landebahn chronisch verstopft. Wir fürchteten, dass wir wie die Flugzeuge vor uns nach Indien weiterfliegen müssten. Endlich konnten wir doch landen und ein Haufen erschöpfter Hilfsarbeiter taumelte aus dem Flugzeug. Die Minimalbelegschaft des Flughafens gab ihr Bestes, uns und unser Gepäck abzufertigen – verständlicherweise waren viele Arbeiter nicht erschienen, weil sie der Verlust geliebter Menschen und ihrer Häuser schwer getroffen hatte.
Das Chaos am Flughafen war ein unheilvoller Start. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von den logistischen Herausforderungen, die uns noch bevorstanden.
Hilfe ins Land bringen – und Hilfe verteilen
Naiver Weise hatte ich angenommen, dass die größte Hürde sein würde, die Hilfe überhaupt ins Land zu bekommen, doch allmählich zeichnete sich das Gesamtbild ab. Teams, die versuchten, Kathmandu in Richtung des Epizentrums zu verlassen, um sich ein Bild von der dortigen Lage zu machen, wurden von zerstörten Straßen und Lawinen gezwungen umzukehren. Elektrizität, Telefon und Internet funktionierten nicht, so dass wir uns nicht mit den Gemeinden darüber abstimmen konnten, was sie genau brauchten – wir konnten sie nicht mal wissen lassen, dass wir versuchten, sie zu erreichen.
Während unsere Logistikteams verzweifelt daran arbeiteten, Hilfe ins Land zu bringen, mussten sie gleichzeitig Lagerhallen finden, die nach dem schweren Erdbeben noch als solche zu gebrauchen waren, sicher und groß genug, um die Hilfsgüter unterzubringen. Und schließlich mussten wir genug LKWs und entsprechend viel Benzin zu finden, um die Güter zu diesen Lagern zu transportieren und dann in den Gemeinden verteilen zu können. Unser Team hat die ganze Nacht durchgearbeitet und dabei vergessen, zu essen, zu schlafen.
Abkürzungen sind gefährlich
Es ist für jeden enttäuschend, vor allem für betroffene Familien, wenn derlei Herausforderungen dazu führen, dass lebensnotwendige Dinge nicht sofort verteilt werden können. Andererseits: Wenn wir bei der Hilfsarbeit hetzen, machen wir Fehler. Und diese Fehler können tödlich sein.
Zu wenige Güter dabei zu haben, kann dazu führen, dass sich Frust in verärgerten Mobs entlädt. Wenn man einfach drauf los fährt, kann es sein, dass man die Bedürftigsten nicht erreicht, weil sie sich an eine andere Stelle zurückgezogen haben oder sich zu bestimmten Zeiten nur drinnen aufhalten. Verteilt man die falschen Nahrungsmittel, kann man lokale Märkte untergraben oder Menschen krank machen. Kurz gesagt: Zu begutachten und zu planen kostet Zeit, beides ist aber notwendig, um angemessene Katastrophenarbeit zu leisten – eine die hilft, und nicht schadet.
Erhabene humanitäre Ideale mögen den Familien nichts bedeuten, die unter einem Baum Zuflucht gefunden haben. Wir Helfer sind uns dessen schmerzlich bewusst. Und Gott weiß, dass wir alle gerne die Abkürzung nähmen. Aber das können wir nicht: die Rückwirkungen sind zu gravierend. Auf der anderen Seite kann uns kaum etwas glücklicher und zufriedener machen als eine gut durchdachte und organisierte und deshalb lebensrettende Hilfsverteilung.
Ein Trost
Kameras, Journalisten und Kritik reisen schneller als Helfer das jemals können und ich bin sicher, dass die Medien die Langsamkeit des allgemeinen Hilfseinsatzes bemängeln werden. Aber das ist ok.
Es ist ok, weil Save the Children heute drei große LKWs, voll beladen mit Hilfsgütern, in drei verschiedene Richtungen los geschickt hat, in drei der am stärksten betroffenen Gebiete.
Es ist ok, weil wir gestern Hilfsmittel in Kathmandu verteilt haben, so dass hunderte von Familien nun Dächer über dem Kopf haben, und dass 136 Tonnen mit Hilfsgütern auf dem Weg sind.
Es ist ok, weil es wichtig ist, dass wir uns selbst und die Effizienz unserer Arbeit laufend in Frage stellen und uns selbst immer wieder in die Verantwortung für unsere Schutzbefohlenen stellen müssen.
Vor allem aber ist es ok, weil wir um die Hürden wissen, die wir auf dem Weg überwinden mussten, um Familien unterstützen zu können. Vor allem die Hilfsarbeiter der ersten schrecklichen Stunden vor Ort können davon ein Lied singen.